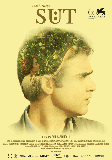Rüdiger Suchsland / FAZ
Träume sind Milchschäume
Aus dem Leben eines Taugenichts – vom Erwachsenwerden in der Provinz
Man erkennt nicht sofort, worum es geht. Als ein paar Männer eine junge Frau an den Füßen binden und an einem Baum hochziehen, und über ihrem Kopf ein Feuer entfachen, mag mancher gleich all seine Vorurteile gegenüber der Türkei bestätigt fühlen. Dann wird auf dem Feuer ein Kessel mit Milch zum Kochen gebracht, und als die Dunstschwaden in ihr Gesicht steigen, ringelt plötzlich aus dem Mund der Frau eine Schlange hervor – und wahnsinniger Moment von archaischer Kraft, gleich in der ersten Einstellung dieses Films. Es gibt ein paar solcher Bilder in Süt, die man auch lange nach dem Film nicht wieder vergessen kann.
Was das alles soll, ist eine andere Frage. Ein schamanisches Ritual, ein Exorzismus, keineswegs naturalistisch gemeint, sondern eine verspielte Bestätigung der auf magischen Realismus zielenden Erwartungen, die auch in der Türkei das gebildete urbane Publikum gegenüber dem fremd gewordenen Landleben mit seinen Traditionen, Bräuchen und Geheimnissen hegt – und zugleich deren ironische Brechung. Man darf vermuten, dass der Regisseur Semih Kaplanoglu auch einfach den Zauber eines solchen Filmmoments auskostet, die pure Schönheit des Augenblicks, in dem sich die Schlange zeigt.
Süt, auf deutsch »Milch«, hatte seine Premiere 2008 beim Filmfestival in Venedig und ist der zweite Teil einer Trilogie, in der Kaplanoglu von Yusuf erzählt: Der erste, Yumurta (Das Ei) lief 2007 in Cannes, der dritte mit dem Titel Bal (Honig) wird in wenigen Wochen im Wettbewerb der Berlinale zu sehen sein. Aber auch wenn es untereinander Bezüge gibt, steht jeder Film für sich, zumal das Ganze gegen die Chronologie rückwärts erzählt ist: In Yumurta kam Yusuf als Mittdreißiger zur Beerdigung seiner Mutter in sein Heimatdorf zurück; als latent frustrierter Intellektueller, dessen Hoffnungen sich in der Metropole Istanbul nicht ganz erfüllt haben. Dies im Gedächtnis erlebt man Yusuf nun als etwa Achtzehnjährigen. Er ist mit der Schule fertig, und soll, wenn es nach seiner Mutter geht, etwas Anständiges lernen, und endlich die Flausen los werden: Yusuf träumt nämlich von einem Leben als Schriftsteller, in seinem Zimmer hängt ein Bild von Rimbaud, wenn endlich Ruhe eingekehrt ist, tippt er nachts Gedichte in seine Schreibmaschine, die er dann an Literaturzeitschriften schickt – und eines Tages werden sogar ein paar veröffentlicht. Für die Älteren seines Dorfes ist er ein Taugenichts, genau so wie für die Mädchen, die nichts anzufangen wissen mit diesem verstockten Schüchternen, der seinen Mund nicht aufbekommt, und noch nicht mal ein Kaugummi annimmt, das ihm die Dorfschönheit aufmunternd anbietet.
Es ist nicht leicht warm zu werden mit diesem Yusuf. Er hat wenige Freunde, ist ein Schweiger, und selbst seiner eher praktisch veranlagten Mutter ein Rätsel. Immerhin hilft er ihr Milch und Käse auszufahren, im nahen Markt zu verkaufen, weil er aber bei jeder Gelegenheit Gedichte schreibt, bleibt er dann doch ein Sorgenkind, zumal er ab und zu epileptische Anfälle bekommt – ein Leiden, das in der Kulturgeschichte schon immer für ein besonderes Verhältnis zu den Göttern stand. Vieles in diesem Film kann in dieser Weise auch auf mindestens einer zweiten Ebene verstanden werden: Die Milch ist eben einerseits das, womit Mutter und Sohn ihr Überleben sichern, aber auch das Symbol der Mutter-Kind-Beziehung schlechthin. Milchartig sieht auch der Schaum aus, der Yusuf bei seinen Anfällen mitunter vor dem Mund steht. Und Milch ist schließlich die Medizin, mit der die Bauern im Ritual zu Beginn die Schlangen aus dem Leib treiben.
Symbolisch und mythenschwanger sind Kaplanoglus Erzählweise und seine Bilder also schon. Aber weniger bedeutungsträchtig und grundsätzlich wie bei Tarkowski, als reflektiert und mit immer mehr als nur einer einzigen eindeutigen Bedeutung. Darin erinnert Süt wie schon Yumurta eher an Antonioni und noch stärker an Renoir, auf dessen The River auch dieser Film mehrfach anspielt. Kaplanoglu, der aufsteigende Stern des türkischen Gegenwartskinos, ist ein Realist, der bei aller Eleganz überaus gelassen erzählt, nüchtern und streckenweise ironisch, sogar mit gelegentlichen kurzen Slapstick-Momenten. Zugleich entwickeln die in langen Einstellungen erzählten Szenen immer wieder einen starken poetischen Sog. Beim Wettbewerb in Venedig fand die eine oder andere den Film seinerzeit trotzdem zu prätentiös. Sieht man ihn jetzt frei von irgendwelchen Festivalerschöpfungen, kann man sich in ihm leichter verlieren, sieht man nicht nur schöne Einzelmomente, sondern bemerkt, wie genau alles gearbeitet ist und miteinander zusammenhängt.
Kaplanoglu verfügt über eine seltene Fähigkeit, in kleinen Andeutungen, quasi zwischen den Bildern viel zu erzählen. Natürlich geht es daher in dieser Geschichte vom Erwachsenwerden eines jungen Unzufriedenen in der Provinz auch um die Gegensätze zwischen Tradition und Moderne, in der Türkei wie anderswo. Aber mehr noch geht es um das Verhältnis von Traum und Leben, und um die Bedeutung des einen für das andere.
Am Ende stapft Yusuf, der entdeckt hat, dass seine Mutter einen Liebhaber hat, und diesen, erfüllt von ödipalen Mordgelüsten, verfolgt, durchs Schilf einer Uferlandschaft. Plötzlich, ehe man als Zuschauer ganz begriffen hat, was passiert, hat er mit seinen Händen einen riesengroßen Fisch gefangen, den er kaum halten kann. Noch so ein Bild, bei dem man sich fragt, was es genau sagen möchte. Aber auch wieder ein Bild, das man nicht vergisst.
|
|
|